
 Was, wenn der Pharmaleitmarkt fällt?
Was, wenn der Pharmaleitmarkt fällt?
Das Businessmodell der Arzneimittelforschung und -entwicklung hat seine Basis in den hohen Medikamentenpreisen, die Nutzer in den USA bereit sind zu bezahlen. Die Hälfte des globalen Pharmaziemarktes findet daher in den USA statt, obwohl dort nur 4% der Weltbevölkerung leben. Das viele Jahrzehnte geübte Modell gerät nun ins Wanken, ob es endgültig fällt oder nur schwächer oder stärker verändert werden wird, weiß derzeit niemand zu sagen. Die hohen Preisvorstellungen und Hoffnungen auf den Return-on-Investment werden sich aber reduzieren müssen.
Bereits vor Jahrzehnten kochte die Diskussion um die hohen Gesundheitskosten in den USA hoch und führte schließlich zum New-York-Times-Bestseller „An American Sickness“ von Elisabeth Rosenthal (2017), der eindrücklich die Missstände aufzeigte und deutlich machte: der Turbokapita-
lismus, der sich bei den Arzneimittelpreisen entwickelt hatte, kann so nicht auf Dauer weitergehen. Bis in die heutigen Tage hinein haben dennoch alle Akteure des Systems, das gerne euphemistisch als Ökosystem bezeichnet wird, aber eher einem Haifischbecken gleicht, so agiert, als würde dieses System auf ewig fortlaufen. Ganze globale Wertschöpfungsketten sind darauf aufgebaut, dass am Ende die US-Amerikaner extrem hohe Medikamentenpreise bezahlen.
Die Milliardeninvestitionen in die Arzneimittelentwicklung, in die Finanzierung von Medikamentenkandidaten in der eigenen Pipeline oder derjenigen von Biotech-Start-ups, die milliardenschweren Firmenübernahmen im Pharmabereich, die vagabundierenden Millionen zwischen den VC-Investoren und deren Geldgebern – diese ganze Multimilliarden-Lotterie mit der FDA-Zulassung als Sechser im Lotto, war und ist für globale Medikamentenfirmen nur möglich, weil die Pharmaindustrie in den USA besonders hohe Preise erzielen kann. Damit wurde die Maschinerie des Systems immer wieder mit den hohen Umsatzerlösen und Gewinnen geölt.
Lesen Sie hier weiter, wie das Drohgebaren rings um die Einfuhrzölle die europäische Pharmaindustrie bewegt, ihre Investitionen in Produktionskapazitäten in den USA deutlich zu erhöhen. Wie sich der bisherige hohe Marktanteil Europas in den USA durch eine Veränderung der Allokation von Wertschöpfung verändern dürfte. Warum Japan als Negativbeispiel gilt. Wieso einige Pharmaverbände nun illusorischerweise fordern, das Preismodell der USA (aus früheren, goldenen Zeiten) auf Europa zu übertragen. Und wie träge bisher die Gegenreaktionen ausfallen. Warum ist das so? Auch für den Mangel an Innovationsaufnahme durch die großen europäischen Pharmafirmen gibt es Expertenstimmen, lieber wird aus den USA oder aus China eingekauft, als das Start-up vor der Haustüre wahrzunehmen. Das kaufen dann aber US-Pharmafirmen weg.
Dass der milliarden-erlös-getriebene US-Weg vielleicht für Europa in die Irre führt, diskutieren eine Reihe von Branchenvertreter deren Stimmen wir in dem Artikel dokumentieren. Im Idealfall sorgt die hochgezogene Zollzugbrücke für eine Rückbesinnung Europas auf eigene Stärken, eigene Märkte, die eigene Innovationskraft aus der exzellenten Forschung heraus – und eventuell sogar für eine neue Gründerdynamik.
Hier geht es zum vollständigen Artikel:

 Basel Area Business & Innovation; Jean Jaques Schaffner
Basel Area Business & Innovation; Jean Jaques Schaffner sdecoret - stock.adobe.com
sdecoret - stock.adobe.com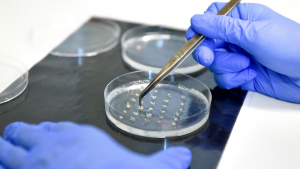 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung IPK Gatersleben, Andreas Baehring
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung IPK Gatersleben, Andreas Baehring